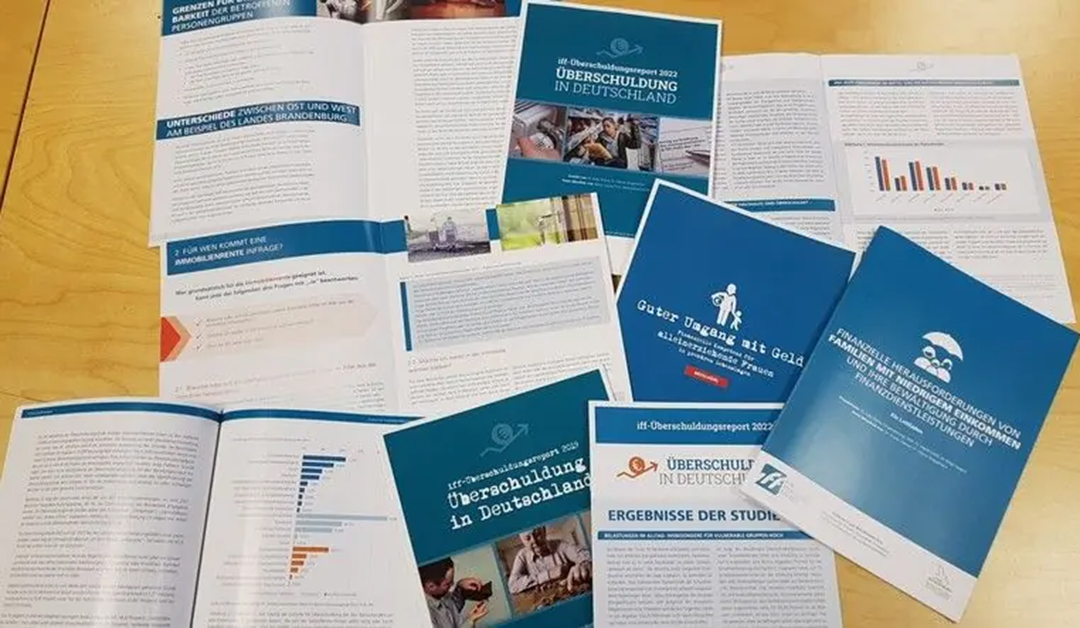Hier der Hinweis auf die Entscheidung des Bundessozialgerichts vom 03.12.2024, B 2 U 11/22 R. Die Entscheidung dürfte herausragende grundsätzliche Bedeutung haben (vgl. zur Aufrechnung etwa LSG NRW und anders LSG München).
Leider liegt die Entscheidung noch nicht im Wortlaut vor, aber Terminvorschau und vor allem der Terminsbericht sind sehr lesenswert. Daraus:
„Der Kläger war Anfang der neunzehnhundertneunziger Jahre Inhaber einer Baufirma, deren zuständiger Unfallversicherungsträger die Rechtsvorgängerin der Beklagten war. Für die Jahre 1992 und 1993 erhob diese Beiträge, die der Kläger nicht beglich. Der Kläger bezieht wegen der Folgen eines Arbeitsunfalls seit 1999 von der Beklagten eine Verletztenrente nach einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 20 von Hundert.
Das am 1. Dezember 2010 eröffnete Regelinsolvenzverfahren über das Privatvermögen des Klägers führte nur zu einer geringfügigen Befriedigung der Beitragsforderungen. Das Amtsgericht erteilte dem Kläger am 26. Januar 2017 die Restschuldbefreiung. Im Anschluss erklärte die Beklagte die Aufrechnung der nicht beglichenen Beitragsforderungen mit dem hälftigen – unpfändbaren – Anspruch auf Verletztenrente (Bescheid vom 4. April 2017, Widerspruchsbescheid vom 20. Dezember 2017). (…)
Der Beklagten steht nach Erteilung der Restschuldbefreiung keine Aufrechnungsbefugnis in Höhe des hälftigen Anspruches auf Verletztenrente gegen den Kläger zu. Die Voraussetzungen einer Aufrechnung lagen nach Erteilung der Restschuldbefreiung mangels Aufrechnungslage nicht mehr vor. Die Beitragsforderung der Beklagten ist mit Erteilung der Restschuldbefreiung zu einer unvollkommenen, rechtlich nicht durchsetzbaren Forderung geworden (§ 301 Absatz 1 InsO).